
Amnon Rubinstein
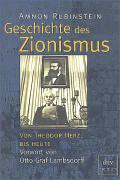 |
Pünktlich zu seinem 70.
Geburtstag und gleichzeitig passend zur aktuellen antizionistischen
Kampagne in
Durban,
erschien beim
dtv die deutsche
Erstauflage von Amnon Rubinsteins "Geschichte
des Zionismus".
Einführung:
Basel und Jerusalem
Von Amnon Rubinstein
Am Samstag, den 28. August 1897 — einem besonders heißen
Tag — versammelten sich in der Synagoge in Basel unzählige Gläubige. Die kleine
Schweizer Stadt stand nicht jeden Tag im Mittelpunkt von soviel Aufmerksamkeit.
In der kleinen jüdischen Gemeinde und in den Straßen der Stadt liefen die
Vorbereitungen für den Ersten — und vielleicht letzten — Zionistenkongress auf
Hochtouren.
Überall waren Juden: begeisterte Studenten aus Rußland und
Berlin, Rabbiner und Geschäftsleute, Professoren von deutschen Universitäten,
Ladenbesitzer, Intellektuelle und Dichter, Bauern und Mitglieder der begüterten
Klassen. Sie kamen aus Algier und Bukarest, Odessa und London, Paris und
Kattowitz — und alle beteiligten sich auf ihre Art und Weise erwartungsvoll und
eifrig an dem Stimmengewirr aus aufwogenden Gefühlen, intellektuellen Debatten,
Hoffnungen und Befürchtungen. Würde von Basel eine neue Lehre ausgehen? Oder
würde der Erste Zionistenkongreß nur eine ebenso rasch vergessene Episode sein
wie die anderen hoffnungslos dem Untergang geweihten Versuche jüdischer
Organisationen, die Situation der Juden zu verbessern?
Doch es gab einen besonderen Grund für die aufgeladene
Atmosphäre in der Synagoge: Theodor Herzl — der Journalist, Autor und
Dramatiker, der im Jahr zuvor durch die Veröffentlichung eines dünnen Büchleins
mit dem Titel >Der Judenstaat< einen Sturm ausgelöst hatte, ein Mann, der, egal
wo er auftauchte, Gegenstand von Bewunderung, Widerstand und Spott war — kam zur
Synagoge und würde zum Altar hinaufsteigen, um zur Torah aufgerufen zu werden.
Der assimilierte Herzl, dessen Bar Mizvah in einer Budapester Synagoge seine
letzte verschwommene Erinnerung an irgend etwas Jüdisches war, legte sich einen
Gebetsschal um und rezitierte den Segen in einer fremden Sprache — Hebräisch.
Am 9. September nach dem Kongreß wieder in Wien, als die
Aufregung, die Hochrufe und das »Lang lebe der König« langsam verblaßten,
schrieb Herzl, in Erinnerungen schwelgend, in sein Tagebuch:
»Ich ging, aus Rücksicht auf das religiöse Bedenken am Samstag
vor dem Congress in den Tempel. Der Gemeindevorstand rief mich auf. Ich ließ mir
vom Schwager meines Freundes Beer aus Paris, Herrn Markus aus Meran, die Broche
(den Segensspruch) eintrichtern. Und als ich zum Altar hinaufging, war ich
aufgeregter als an allen Congresstagen: Die wenigen Worte der hebräischen Broche
machten mir mehr Beklemmung als meine Begrüssungs- u. Schlussrede u. die ganze
Leitung der Verhandlung.«1
Der Sabbat in der Synagoge in Basel hatte etwas ähnlich Einzig
artiges: Auch Max Nordau — ein assimilierter Jude, der sich mit einer Reihe
umstrittener Bücher einen Namen gemacht hatte und in ganz Europa als erklärter
Atheist bekannt war — kam in die Synagoge. Seiner Familie schrieb er in einem
Brief folgendes über den Besuch:
»Kaum war ich heute morgens angekommen, machte ich mich auf
die Suche nach Herzl. Ich nahm einen Wagen und fuhr in die Synagoge, denn ich
wußte, daß Herzl dort sei. Ich hatte jedoch ganz vergessen, daß es Samstag war.
Anstatt nur den Tempeldiener zu finden, bin ich mitten in den Gottesdienst
geraten und fand Herzl angetan mit einem Gebetsmantel. Das hat mich ganz aus der
Fassung gebracht. Man wollte mich rufen >das Gesetz lesen, ist eine Ehre<, aber
ich habe verzichtet und bin bestürzt fortgegangen ... «2
1 Theodor Herzl: Briefe und Tagebücher. Bd. 2: Zionistisches
Tagebuch 1895—1899. Berlin 1984, S. 544—545.
2 Max Nordau: Erinnerungen. Erzählt von ihm selbst und von der Gefährtin seines
Lebens. Leipzig, Wien 1928, S. 183.
Der folgende Tag ist vollkommen anders. In der Haupthalle des
Kasinos der Stadt herrscht eine feierliche, aufgeregte Atmosphäre. Die
Delegierten — auch Nordau, der sich dem Diktat vergeblich widersetzt hatte —
tragen auf Herzls Bitte Gehröcke; es werden Reden gehalten, unterbrochen von
donnerndem Applaus. Herzl ist überall, kontrolliert den Ablauf sowohl als
Regisseur als auch als Produzent, regelt die Details, leitet das Ganze nach den
parlamentarischen Verfahren, die er als Korrespondent einer Wiener Zeitung im
Palais Bourbon, dem Sitz der Nationalversammlung in Paris, kennengelernt hat.
Nordau, Anhänger eines extremen Individualismus und
leidenschaftlicher Gegner des Nationalismus, spricht aus dem Stegreif zu der
versammelten Menge; er spricht von den Problemen der Juden und der
Notwendigkeit, sie von der Unterdrückung zu befreien. Herzl und Nordau — beides
assimilierte Juden, deren gewaltiges Abweichen vom traditionellen Judentum einen
Tag zuvor in der Synagoge noch unterstrichen worden war — sprechen von eben dem
jüdischen Volk, dem sie jetzt als Wortführer, Propheten, Priester und Führer
dienen wollen.
Herzl wendet sich an den Kongreß:
»Schon hat der Zionismus etwas Merkwürdiges, ehedem für
unmöglich Gehaltenes zuwege gebracht: die enge Verbindung der modernsten
Elemente des Judentums mit den konservativsten. Da sich dies ereignet hat, ohne
daß von der einen oder der anderen Seite unwürdige Konzessionen gemacht, Opfer
des Intellekts gebracht worden wären, so ist dies ein Beweis mehr, wenn es noch
eines Beweises bedürfte, für das Volkstum der Juden. Ein solcher Zusammenschluß
ist nur möglich auf der Grundlage der Nation.«3
3 Theodor Herzl: Eröffnungsrede zum Ersten Kongress. In:
Theodor Herzl: Zionistische Schriften. Hg. von Leon Keller. Berlin o.J.,
5.222—223.
Denkt er, während er diese Worte ausspricht, an sein Treffen
in dem Hotel mit einer Delegation von Rabbinern, die auch an dem Kongreß
teilnehmen — eine kleine, wenn auch wichtige Minderheit —, und an seinen Besuch
in der Synagoge am Tag zuvor? Denkt er über die Welt des osteuropäischen
Judentums nach, vertreten durch Juden aus dem zaristischen Rußland? Er steht vor
einem Querschnitt dieser so verschiedenen Menschen, die sich in Sprache, Kultur,
Lebensstil und religiöser Einstellung voneinander unterscheiden. Auf Herzls
Einladung hin haben sie sich in Basel getroffen, um über die mißliche Lage eines
heimatlosen, landlosen Volkes nachzudenken, das über die ganze Welt verstreut
ist. Verbunden sind sie durch das Jüdische Problem, das wiederum an
verschiedenen Orten unterschiedliche Formen annimmt. Der gemeinsame Nenner ist
das universale Bedürfnis der Juden nach Erlösung von ihrer Drangsal, Befreiung
aus dem umfassenden Zustand des Unbehagens und persönlicher Scham — das
Bedürfnis, eine Nation zu werden, gleich zu sein in einer Gesellschaft von
Gleichen.
Auch der Schriftsteller und Philosoph Achad Haam — ein
skeptischer Beobachter — reagiert auf die Ereignisse in Basel:
»Von all den hochtrabenden Zielen, die der Zionismus sich
gesetzt hat, ist nur eines zur Zeit in Reichweite; und zwar das moralische Ziel,
uns selbst aus der Sklaverei des inneren Wesens zu befreien, von dem
unterdrückten menschlichen Geist, der durch die Assimilation entstand. Wir
müssen unsere nationale Einheit stärken, indem wir in allen Aspekten der
Existenz unserer Nation zusammenarbeiten, bis wir bereit sind für ein Leben in
Würde und Freiheit — in den Tagen, die kommen werden.«4
4. Arthur Hertzberg (Hg.): The Zionist Idea. New York 1966,
5.83.
Die Juden, die sich in Basel versammeln, möchten einzigartig
unter den Nationen sein — ein Volk, für das moralische Grundsätze und die Regeln
des Gesetzes untrennbar miteinander verbunden sind. Herzl drückt das so aus:
»Überall soll man erfahren, was der Zionismus, den man für
eine Art von chiliastischem Schrecken ausgab, in Wirklichkeit ist: eine
gesittete, gesetzliche, menschenfreundliche Bewegung nach dem alten Ziel der
Sehnsucht unseres Volkes.«5
Ein paar Tage vor dem Kongreß hatte Herzl, auf dem drohender
Hohn und Spott wie immer schwer lasteten, am 24. August im Zug nach Basel
folgenden Eintrag in sein Tagebuch gemacht:
»Thatsache ist, was ich Jedermann verschweige, dass ich nur
eine Armee von Schnorrern habe. Ich stehe nur an der Spitze von Knaben, Bettlern
und Schmöcken. Manche beuten mich aus. Andere sind schon neidisch oder treulos.
Die Dritten fallen ab, so wie sich ihnen eine kleine Carrière eröffnet. Wenige
sind uneigennützige Enthusiasten. Dennoch würde dieses Heer vollkommen genügen,
wenn sich nur der Erfolg zeigte. Da würde es rasch eine stramme reguläre Armee
werden. Wir werden also sehen, was die nächste Zukunft bringt.«6
Aber am 30. August hatte sich seine Stimmung verändert:
»Die Geschichte des gestrigen Tages brauche ich nicht mehr zu
schreiben, die schreiben jetzt bereits andere.«7
5. Theodor Herzl: Eröffnungsrede zum Ersten Kongreß. In:
Theodor Herzl: Zionistische Schriften. Hg. von Leon Keller. Berlin o. J., S.
227.
6 Theodor Herzl: Briefe und Tagebücher. Bd. 2: Zionistisches Tagebuch 1895—1899.
Berlin 1984, S. 535.
7. Ebda., S. 538.
Seine Kollegen bei der >Neuen Freien Presse< in Wien begrüßen
ihn scherzhaft als den »König der Juden«. Als er sich von seinen anstrengenden
Arbeiten allmählich erholt und der emotionale Aufruhr durch die Ereignisse
langsam wieder nachläßt, findet Herzl die prophetischen Worte, die durch die
moderne Geschichte des Judentums widerhallen werden. Am 3. September schreibt er
in sein Tagebuch:
»Fasse ich den Baseler Congress in ein Wort zusammen — das ich
mich hüten werde öffentlich auszusprechen — so ist es dieses: in Basel habe
ich den Judenstaat gegründet. Wenn ich das heute laut sagte, würde mir ein
universelles Gelächter antworten. Vielleicht in fünf Jahren, jedenfalls in
fünfzig wird es Jeder einsehen. Der Staat ist wesentlich im Staatswillen des
Volkes, ja selbst eines genügend mächtigen Einzelnen (l'etat c'est moi Ludwig
XIV) begründet. Territorium ist nur die concrete Unterlage, der Staat ist selbst
wo er Territorium hat immer etwas Abstractes. Der Kirchenstaat besteht auch ohne
Territorium, sonst wäre der Papst nicht souverän. Ich habe also in Basel dieses
Abstracte u. darum den Allermeisten Unsichtbare geschaffen. Eigentlich mit
infinitesimalen Mitteln. Ich hetzte die Leute allmälich in die Staatsstimmung
hinein u. brachte ihnen das Gefühl bei, dass sie die Nationalversammlung seien.«8
8. Ebda., 5.539.
Herzl schreibt diese Worte zu einer Zeit, in der der
Zionismus, den er sich ausgedacht und den er begründet hat, trotz der
enthusiastischen Begeisterung auf dem Kongreß immer noch eine esoterische
Randerscheinung ist.
Der Kongreß ist eine Quelle, aus der nur ein dünnes Rinnsal
fließt. Der Zionismus kann sich nicht auf politische Unterstützung berufen: Es
gibt keinen einzigen Hinweis darauf, dass der Sultan in Konstantinopel auf die
Träume — andere würden sie als Halluzinationen bezeichnen — des Wiener
Journalisten eingeht; die wohlhabenden Juden der Welt und die große Mehrheit der
religiösen Führer stehen ihm entweder ablehnend oder ambivalent gegenüber.
Verglichen mit den großen Bewegungen des Judentums — Assimilation, Orthodoxie,
Reformation, Revolution — scheint diese Quelle fast versiegt zu sein.
Innerhalb der jüdischen Gemeinden herrscht Aufregung —
besonders in Osteuropa —, und es gibt auch viel Widerstand. Nicht nur die
Ultraorthodoxen stehen dem Zionismus ablehnend gegenüber, sondern auch einige
jüdisch-russische Intellektuelle und die Revolutionäre der Linken. Wichtige
Zeitungen berichten über das Ereignis in Basel — manche in einem positiven
Licht, manche in einem verächtlichen, mit Feindseligkeit durchsetzten Ton. Die
deutsche Botschaft in Bern schickt dem deutschen Kaiser einen ausführlichen
Bericht darüber, was die Juden in Basel im Schilde führen. Auf den Rand des
Dokuments schreibt Kaiser Wilhelm II.:
»Ich bin sehr dafür, dass die Mauschels nach Palästina gehen,
je eher sie dorthin abrücken, desto besser. Ich werde ihnen keine
Schwierigkeiten in den Weg legen.«9
9 Auswärtiges Amt, Politisches Archiv, Abt. 1 A Türkei 195:
Die Juden in der Türkei, Bd.1 (R 14125).
Fünfzig Jahre, nachdem Herzl diese Eintragungen in sein
Tagebuch gemacht hatte, wurde der Jüdische Staat gegründet. Er war nicht ganz
so, wie Herzl ihn sich vorgestellt hatte. Statt von Antisemiten gutgeheißen zu
werden, wurde der Staat erst gegründet, nachdem der Großteil der europäischen
Juden von Mitgliedern eben der Kultur, die Herzl so überaus bewundert hatte,
ausgerottet worden war. Die zukünftigen Bürger reisten nicht — wie in Herzls
Vorstellung — auf luxuriösen Ozeanriesen an, auf denen Orchester im Hintergrund
klassische Musik spielten, sondern auf maroden Schiffen, von denen einige
unterwegs sanken oder versenkt wurden. Sie kamen nicht in Frieden, wie in Basel
prophezeit, sondern mitten hinein in das Blutvergießen und die Geschützfeuer des
Unabhängigkeitskrieges und anderer Kriege, die noch kommen sollten.
Fast einhundert Jahre, nachdem Herzl seine Bemerkungen über
die dem Zionismus innewohnende Moral und Rechtsstaatlichkeit machte, wurde der
Ministerpräsident des Staates Israel, Jizhak Rabin, von einem religiösen
Fanatiker ermordet. Dieser führte seinen teuflischen Plan im Namen des jüdischen
Glaubens und religiöser Gesetze aus, unterstützt vom Rat seiner geistlichen
Führer. Er erschoß einen Mann, dessen Verbrechen es war, hartnäckig an der Idee
des Friedens festzuhalten. Im Verfahren gegen den Mörder sagte Eliezer Goldberg,
Richter am Obersten Gerichtshof:
»Wir haben den Einspruch gehört, den wir hiermit an diesem Tag
zurückweisen, dem zwanzigsten Tag des Tamus, dem Jahrestag des Todes von Herzl.
Herzl war derjenige, der die Vision dieses Staates hatte. Die Möglichkeit, daß
ein jüdischer Führer eines zukünftigen Judenstaates von einem Juden getötet
werden würde, war ihm sicher nicht in den Sinn gekommen. Die Begründer unserer
Nation stellten sich sicher nicht vor, was passieren würde, wenn wir
Unabhängigkeit erlangten. Selbst unsere Generation, die sich des
Auseinanderklaffens zwischen Vision und Wirklichkeit voll und ganz bewußt ist,
kann kaum glauben, daß sich in Israel eine solch ruchlose Tat ereignen kann. Die
Wirklichkeit hat den Begründern und ihren Nachkommen einen kalten, harten Schlag
ins Gesicht versetzt. Tatsache ist, daß der Ministerpräsident des Staates Israel
von dem Berufungskläger ermordet wurde. «10
10 Berufungsverfahren 3126/96, Jigal Amir gegen den Staat,
Dinim Elyon 1996, Bd. 44, S. 396.
Im August 1949 wurden Herzls Überreste nach Israel überführt
und in Jerusalem beerdigt, oben auf dem Hügel, der seinen Namen trägt. Damals
war der Herzl-Berg ein unfruchtbarer Hügel am Stadtrand von Jerusalem — einer
geteilten, schwachen, von einer feindlichen Grenze umzingelten Stadt. Die
Hauptstadt eines belagerten Landes, das den Flüchtlings- und
Einwanderungswellen, die von Ost und West an seine Küsten brandeten, kaum
gewachsen war.
Am 6. November 1996, als Jitzchak Rabin gegenüber von Herzls
Grab zur letzten Ruhe gebettet wurde, war die Szene eine vollkommen andere.
Jerusalem war zu einer großen Stadt herangewachsen, und um den Herzl-Berg herum
konnte man im Norden wie im Süden den Beweis für die rasche Entwicklung sehen,
die sowohl Israel als auch seine Hauptstadt überflutete. Im Herbstlicht konnte
man die Stadt und ihre Vororte überblicken, die frühere Grenze, die Türme und
Minarette, die Parks und bewaldeten Gebiete, die neuen Technologieparks und Yad
Vashem — die Holocaust-Gedenkstätte. Von der Kuppe des Herzl-Bergs konnten
diejenigen, die an der Beisetzung teilnahmen, Jerusalem sehen — gefühlsmäßig
immer noch geteilt zwischen Juden und Arabern und zwischen Juden und Juden,
immer noch keine Stadt des Friedens, aber eine großartige Stadt, erfrischend in
ihrer einzigartigen Schönheit, die Hauptstadt des jüdischen Staates: eines
wohlhabenden und mächtigen Landes, das Satelliten in den Weltraum schießt und
seine Industrieexporte auf Märkte rund um den Globus verschifft.
Dort, gegenüber von Herzls Grab, waren die führenden Köpfe der
Welt versammelt. Könige und Präsidenten, Premierminister und Prinzen,
militärische Machthaber und Intellektuelle. Eine Versammlung von Menschen, wie
es in Jerusalem noch keine gegeben hatte, nicht einmal in seinen alten
Glanztagen. Auch die Köpfe arabischer Staaten waren da: der Präsident von
Ägypten, der König von Jordanien, Vertreter der Palästinenserbehörde und
Delegationen aus Marokko, Tunesien, Oman und Katar. Viele hatten Tränen in den
Augen. Jitzchak Rabin war tot. Ein jüdischer Ministerpräsident war ermordet
worden. Von einem Juden. Im Namen des Judentums. Einhundert Jahre nach dem
Ereignis in Basel.
Amnon Rubinstein
Geschichte des Zionismus
Von Theodor Herzl bis heute
Aus dem Englischen von Elvira Willems
Mit einer Einleitung von Arthur Herzberg
360 Seiten - DM 38,- öS 277,- sFr 34,50
ab 1.1.2002: € [D] 19,50 € [A] 20,-
Deutsche Erstausgabe / ISBN 3 423 24267 1
September 2001
[BESTELLEN]
Deutscher Taschenbuch Verlag
Friedrichstr. 1a, 80801 München,
Telefon: 089-38167119, Telefax: 089-38167333,
zirnbauer@dtv.de /
www.dtv.de
haGalil onLine
07-09-2001 |