| Dialog mit dem Feind
Der israelische Psychologe Dan Bar-On
entwickelt den TRT–Prozess
[Hebräisch
/ Englisch
/ Arabisch]
Beifall brandet auf. Zwei Männer schütteln sich
die Hand. Die etwa tausend Zuhörer in der Würzburger Kongresshalle
erheben sich von ihren Plätzen. Damit ehren sie die beiden Redner, Sami
Adwan und Dan Bar-On. Der Israeli und der Palästinenser umarmen sich.
Eine unglaubliche Geste im Mai 2001: Dort, wo beide herkommen, herrscht
Krieg: täglich sterben Menschen auf den Strassen und in ihren Häusern.
Der Kreislauf von Gewalt und Vergeltung in Israel und Palästina geht
bereits in die dritte Generation. Der Beifall will nicht enden. Da
erhebt sich in der zweiten Reihe ein älterer Herr, geht nach vorn und
legt seine Arme um beide. Es ist Martin Bormann, dessen Vater
>Reichsleiter< Martin Bormann, ein hochrangiger Nazi und enger
Vertrauter Hitlers gewesen ist.
Was viele der Anwesenden, in der Mehrheit Therapeuten,
so berührt, ist die Ehrlichkeit der Versöhnungsgeste, deren Zeugen sie
sind. Eben haben sie zwei Lebensgeschichten gehört, die davon handelten,
wie sich Feindbilder auflösen konnten und wie daraus Zusammenarbeit und
Freundschaft entstand. Der Israeli und der Palästinenser hatten jeder,
zwecks Verteidigung der eigenen Rechte, die andere Nation bekämpft.
Inzwischen arbeiten beide im Rahmen von „PRIME – Peace Research
Institute in the Middle East" – dessen Gründer und Kodirektoren sie
sind, für den Frieden zwischen beiden Völkern. Dan Bar-On, der 1938 in
Haifa geborene Sohn eines aus Hamburg immigrierten jüdischen Arztes und
ehemaliger Offizier der israelischen Armee in drei Nahostkriegen; und
Sami Adwan, heute Professor für Pädagogik an der Universität Bethlehem,
der als Palästinenser im Westjordanland in der ersten Intifada gegen die
Besatzungsmacht gekämpft und dies mit Haft in einem israelischen
Spezialgefängnis in der Negev-Wüste gebüßt hat. Der Weg von der
Feindschaft zur Versöhnung, in einem Umfeld, wo der Kreislauf von
Gewalt, Rache und Gegengewalt unauflöslich zu sein scheint, war ein
langer, langsamer und schwieriger. „TRT – To Reflect and Trust", haben
ihn diejenigen genannt, die ihn mitgegangen sind. Martin Bormann war
einer von ihnen.
Initiator des TRT-Prozesses ist Dan Bar-On, heute
Professor für klinische Psychologie an der Ben-Gurion-Universität in
Beersheva. Die Anfänge von TRT liegen Jahrzehnte zurück. TRT ist keine
neue Therapieform. Es ist ein Dialogprozess, der in seiner
Vielschichtigkeit und Komplexität nur zu verstehen ist, wenn man bis an
die Wurzeln zurückgeht. Einer der Anfänge liegt im Juni 1992. Damals
trafen sich an der Universität Wuppertal achtzehn Menschen zu einem
mehrtägigen Dialog. Alle teilten ein Schicksal: Das Schweigen ihrer
Eltern über einen zentralen Teil der eigenen Biografie. Die Eltern aller
Teilnehmer der Wuppertaler Gruppe waren entweder Opfer und Überlebende
des Holocaust oder aber Mittäter und Organisatoren des Völkermordes.
Opferkinder trafen mit Täterkindern zusammen. Schon allein die Tatsache,
sich zu treffen, mehrere Tage miteinander zu verbringen, sich in einem
Raum gegenüber zu sitzen und miteinander zu sprechen, bedeutete für die
meisten einen schwierigen Schritt. Fast alle waren voller Ängste,
Befürchtungen und Albträume nach Wuppertal gefahren. Sie hatten diesen
Schritt getan in der Hoffnung, dass es auch eine Erlösung sein könnte,
aus dem Gefängnis der Sprachlosigkeit des Schweigens, das ihr Leben
gezeichnet hatte.
Überlebende des Holocaust sind meist schwer
traumatisiert. Das Verschweigen der erlittenen Erniedrigungen ist auch
eine Strategie der Rückkehr in ein normales Leben. Im Israel der
fünfziger und sechziger Jahre, einer Nation der Starken und Siegreichen,
war für eine ausführliche Würdigung dieses Leids der Opfer, außerhalb
der offiziellen Gedenkrituale, kein Raum. Auch für die Nazitäter war das
Verschweigen ihrer Taten und das Verleugnen der Verantwortung für den
Massenmord eine Grundbedingung dafür, in bürgerlicher Normalität
weiterzuleben. Auch im Land der Täter war das Verdrängen Teil der
offiziellen Kultur: Erst Anfang der 60iger Jahre, fast zwei Jahrzehnte
nach Kriegsende, wurde durch den Frankfurter Auschwitzprozess mit der
öffentlichen Aufarbeitung des Holocaust begonnen. So hatte z. B. Hertha
F., die 1992 in Wuppertal mit dabei war, erst im Alter von 20 Jahren
durch die Verhaftung ihres Vaters und den anschließenden Prozess davon
erfahren, dass als er SS-Offizier an Massenmorden in der Ukraine
beteiligt war. Die Erkenntnis, einen Massenmörder zum Vater zu haben,
bestimmte ihr weiteres Leben.
Verdrängen und Verschweigen machen auf die Dauer krank,
physisch und psychisch, was immer die kulturellen Ursachen und die
gesellschaftlichen Kontexte dieser Sprachlosigkeit sind. Einer
strukturellen Ähnlichkeit der Leiden von Täterkindern und Opferkindern
in ihren Auswirkungen auf das Individuum war Dan Bar-On auf die Spur
gekommen, nachdem er in den siebziger und achtziger Jahren in seiner
therapeutischen Praxis mit den traumatisierten Holocaustopfern
gearbeitet hatte, die an Spätfolgen litten. Er begann sich zu fragen,
wie es wohl den Kindern der Täter ergangen sei. Da sich bisher noch
niemand dafür interessiert hatte, macht Dan Bar-On dies zu seinem
Forschungsthema.
Als Angehöriger einer Nation, die ihre Entstehung aus
dem Holocaust definierte, war er niemals „unabhängiger Wissenschaftler"
oder „objektiver Beobachter", sondern aufgrund seiner Biografie, stets
als Beteiligter und Betroffener in den Forschungsprozess involviert.
Durch den Weitblick seines Vaters, hatte die engere Familie Dan Bar-Ons
überlebt: Hans Bruno, ein Hamburger jüdischer Arzt, der aus Heidelberg
stammte, war bereits 1933, nach den ersten diskriminierenden
Nazigesetzen, die seine freie Praxis zerstörten, nach Palästina
ausgewandert, das damals unter britischer Mandatshoheit stand. Dort
wurde Dan 1938 als zweiter Sohn geboren: „Ich wuchs in Haifa deutscher
Kultur auf", erinnert sich der Israeli. Er spricht akzentfrei Deutsch,
weil in seinem Elternhaus, mit den Großeltern nur Deutsch gesprochen
wurde. Als Jugendlicher, Anfang der fünfziger Jahre im eben gegründeten
Staat Israel, kappte Dan Bar-On diese deutschen Wurzeln, hebräisierte
seinen Namen und zog in ein Kibbuz. In den Kriegen von 1956, 1967 und
1973 kämpfte er als Offizier einer Aufklärungseinheit.
Doch das Verdrängen und Verleugnen der eigenen Herkunft
hat seinen Preis. In einer Psychotherapie, die der Israeli in einer
Lebenskrise nach dem Oktoberkrieg von 1973 begonnen hatte, besann sich
Dan Bar-On auf seine deutschen Herkunft: Diesen Aspekt seiner Identität
hatte er als Teil des Nazifeindbildes lange Zeit aus seinem Bewusstsein
ausgeklammert. 1983, inzwischen ausgebildeter Psychologe und
Hochschullehrer, stieß bei einem Forschungsaufenthalt in den USA die
Frage nach den Täterkindern. 1985 kam er zum ersten mal in seinem Leben
nach Deutschland und führte in den folgenden drei Jahren mehr als 90
qualitative Interviews mit erwachsenen Kindern von Nazitätern durch, um
Aufschluss über die psychischen Folgen des Holocaustes für sie zu
gewinnen. (1989 veröffentlicht: „Legacy of Silence: Encounter with
Children of the Third Reich", Harvard University Press, frz., dt.
japanisch, hebräisch).
Bei dieser Arbeit nahm er auch mit Martin Bormann
Kontakt auf und lernte ihn persönlich kennen. „Es war ein hartes Stück
Arbeit und mühsamer Weg dahin", erinnert sich Dan Bar-On. Fast
anderthalb Jahre lang hatten wir uns geschrieben und miteinander
telefoniert, und ich sah unserer ersten persönlichen Begegnung mit Angst
und Unsicherheit entgegen." Sein Gegenüber litt unter ähnlichen
Befürchtungen. Dass beide Männer sich diese Gefühle gegenseitig
eingestehen konnten, legte den Grund für eine persönliche Beziehung.
Aufgrund dieser heilsamen Erfahrung des persönlichen
Dialoges als Opferkind mit einem Täterkind initiierte Dan Bar-On 1992
das erste Treffen in Wuppertal. Die Gruppe gab sich den Namen TRT und
traf sich bis 1997 jedes Jahr, in Deutschland, Israel oder den USA.
Gearbeitet wurde mit der Methode des „story telling": jeder Teilnehmer
erzählte der Gruppe seine persönliche Lebensgeschichte, während die
anderen zuhörten und darauf eingingen. In Wuppertal eröffnete Lena, die
jüdische Ehefrau von Dirk, dem Sohn eines Gestapokommandanten, die
Runde. Sie erzählte, wie sie 1941, im Alter von drei Jahren, das
Massaker an den jüdischen Dorfbewohnern Ukraine überlebt hatte; wie ihre
christlichen Großmutter sie aus einer Schlange vor dem jüdischen Ghetto
heraus riss, den Gestapokommandanten um das Leben ihrer Enkelin anflehte
und sie bis zur Befreiung durch die Rote Armee 1944 auf einem Dachboden
versteckte. Lena berichtete, wie sie später ihre Mutter in Israel wieder
fand, nach Deutschland ging und dort heiratete.
Anschließend erzählte Martin Bormann seine
Lebensgeschichte: Geboren wurde er 1930, Hitler war sein Taufpate.
Martin Bormann besuchte die „NAPOLA", eine Eliteschule für Kinder von
Nazis. Bei Kriegsende verschlug es ihn nach Österreich, wo er von da an
getrennt von seiner Familie lebte. Er wurde katholisch, trat in einen
Orden ein und arbeitete in den sechziger Jahren in der Mission in
Afrika. Aus Gesundheitsgründen gab er den Missionsdienst auf. Später
verließ er den Orden, heiratete und arbeitete bis zu seiner
Pensionierung als Lehrer für katholische Religion und Philosophie.
Insgesamt dauerte es bei diesem ersten Treffen in
Wuppertal dreieinhalb Tage, bis alle Beteiligten ihre Geschichte erzählt
hatten. „Es entstand ein Gefühl der Offenheit und Energie, das ein
Außenstehender wahrscheinlich nicht hätte einordnen können", erinnert
sich ein Teilnehmer. Alle wollten mit diesem positiven Anfang
weiterarbeiten und erklärten sich zu weiteren Treffen bereit. Ein
Ergebnis des Wuppertaler Treffens war, dass die deutschen Täterkinder
eine Selbsthilfegruppe gründeten, die sich mehrere Jahre lang regelmäßig
traf. Das zweite Treffen, dass 1993 in Israel stattfand, war aus
mehreren Gründen sehr viel schwieriger: Zum erstenmal fuhren Täterkinder
offiziell in den Staat der Holocaustopfer, besondere
Sicherheitsmaßnahmen waren, z.B. für Martin Bormann, nötig.
Da die BBC das Treffen für eine Dokumentationssendung
filmte, entstand eine Hierarchie in der Gruppe – ein Widerspruch zu
ihrer ursprünglich symmetrischen Struktur. Auch inhaltlich war die
Fortsetzung des Prozesses schwierig: nach der Euphorie des Anfangs war
jedes Mitglied in seinen soziales Umfeld zurückgekehrt. Fast alle hatten
bei ihren Familien und Freunden, jüdischen wie deutschen, Ablehnung und
Unverständnis erlebt. Die TRT-Gruppe stand also vor dem Dilemma, sich zu
isolieren oder aber dem Druck nachzugeben und sich aufzulösen. Die
TRT-Gruppe entschied sich dafür, die Spannung auszuhalten und weder das
positive Gefühl des Vertrauens, das durch die Begegnung entstanden war,
aufzugeben, noch die Beziehungen außerhalb der Gruppe. Nicht alle
konnten das Dilemma ertragen: Einige Mitglieder verließen die Gruppe,
andere kamen hinzu. Am dritten Treffen nahm Martin Bormann deshalb nicht
teil, weil er fürchten musste, dass seine Anwesenheit von amerikanische
Nazis für ihre Propaganda genutzt würde. Hier zeigte sich, welchen
Einfluss die Geschichte, auch nach fast einem halben Jahrhundert, auf
das persönliche Leben einzelner Teilnehmer der TRT-Gruppe hatte.
Während des sechs Jahre dauernden Dialogprozesses, den
Dan Bar-On begleitete, stellte der israelische Forscher zahlreiche
strukturelle Ähnlichkeiten im Leben der Opferkinder und der Täterkinder
fest. Angehörige beider Gruppen mußten mit der ständigen Präsenz des
Holocaustes leben. Sie fühlten sich entfremdet und entwurzelt und
erlebten die Ablösung von den eigenen Eltern als ausgesprochen
schwierig. Der Dialog war für alle ein befreiender, aber auch
schmerzhafter Lernprozess, der es ihnen ermöglichte, einen neuen Weg zu
finden, mit der Vergangenheit zu leben. Für einige bedeutete es, Teile
der eigenen Identität, nämlich als Opfer im Hass auf die Täter im Recht
zu sein, aufzugeben. „Mein Hass war grenzenlos und instinktiv, er wuchs
mit jedem Buch, Film oder Artikel, den ich über den Holocaust las",
erinnert sich die Miriam K. an ihre Befindlichkeit vor dem TRT-Prozess.
„Doch in dieser Gruppe begriff ich, dass es ehrliche anständige Deutsche
gibt, die für das, was ihre Landsleute während des Zweiten Weltkrieges
begangen haben, große Scham und starke Schulgefühle empfinden, obwohl
sie selbst unschuldig sind. Es ist mir klar geworden, dass es
unwahrscheinlich hilfreich ist, die Geschichte der anderen zu hören und
die eigenen Geschichte in einer Umgebung zu erzählen, die Sicherheit
bietet. Dieser Heilungsprozess kann nur dann geschehen, wenn Menschen
von beiden Seiten zusammenkommen. Wenn man in der eigenen Familie und in
der Gruppe der Opfer ist, ist es so einfach, im Schmerz und in der Wut,
ja sogar im Hass zu verharren und sich an die Opferrolle zu gewöhnen. In
der Gruppe der Täter scheint es die größte Hürde zu sein, sich von den
immensen Schulgefühlen frei zu machen. Da ich drei Töchter habe, musste
ich mich einfach diesen Problemen stellen, denn ich möchte auf keinen
Fall, dass sie eine ganze Nation aufgrund von historischen Ereignissen
hassen", fasst die jüdische Amerikanerin ihre Motivation, sich dem
schwierigen Prozess zu stellen, zusammen.
Dass der Holocaust bei den Nachkommen von Tätern und
Opfern immer präsent ist, sei unvermeidlich, resümiert Dan Bar-On seine
Untersuchung. Doch der negative Einfluss auf das Leben kann durch den
bewussten Verarbeitungsprozess, der im TRT-Dialog stattfindet,
vermindert werden. Die Folgen werden weniger bedrohlich und
selbstzerstörerisch, denn durch den Dialog wird es allen Betroffenen
möglich auf eine erträgliche Art damit zu leben.
Auf ihrem sechsten Treffen 1997 beschloss die
TRT-Gruppe, ihrer Arbeit eine neue Qualität zu geben: Sie wollten die
eigenen positiven, als heilsam erlebten Erfahrungen mit der dialogischen
Aufarbeitung des eigenen Traumas, das Teil eines kollektiven Traumas
ist, an Menschen weitergeben, die in aktuellen Konflikten leben. Die
Hamburger Körber-Stiftung unterstützte diesen Schritt. So trafen sich im
Frühsommer 1998 in Hamburg Mitglieder der TRT-Gruppe mit eingeladenen
Multiplikatoren aus Ländern die jahrzehntelange Konflikte erlebt hatten:
Katholiken und Protestanten aus Nordirland, Farbige und Weiße
Südafrikaner und sowie Palästinenser und Israelis. Dabei erlebten die
Beteiligten, welchen Unterschied es macht, ob der Dialog über einen
historischen oder gegenwärtigen Konflikt geführt wird. Miriam K.
erinnert sich, wie sie unbedingt an der Südafrikagruppe teilnehmen
wollte, dann aber begriff, dass sie sich dem
israelisch-palästinensischen Konflikt stellen musste. Das Anhören der
palästinensischen Geschichten war für sie fast unerträglich: „Als der
erste Palästinenser über sein Leben, seine Vergangenheit, seine aktuelle
und schmerzhafte Realität in der West Bank sprach, stellte ich fest,
dass ich in der Defensive war und mich peinlich berührt, geschockt und
verärgert fühlte. Es fiel mir sehr schwer zu glauben, es handele sich
keineswegs um eine Ausnahme und deshalb sei es unfair, so zu tun, als
sei es die >Normalität< für Palästinenser. Natürlich traute ich mich
nicht, diese Gedanken zu äußern."
Wieder erzählte Miriam K. ihre Geschichte als Nachkommin
von Holocaustopfern, doch diesmal erlebte sie, wie die eigene
Opfer-Identität zu bröckeln begann: „Als der nächste Palästinenser
sprach, wand ich mich. Schon wieder war es eine Geschichte über
Verfolgung, Angst und unerträgliche Erniedrigung. Ich konnte nicht
glauben, was ich hörte. Wie war das möglich? Je mehr ich hörte, desto
mehr schauderte ich. Es war mir peinlich, Jüdin zu sein. Ich konnte den
Gedanken nicht ertragen, dass meine jüdischen Mitmenschen diesen Leuten
solchen Schmerz und solches Grauen zufügten. Ich wollte ihre Taten
verteidigen, sie als ein Bedürfnis nach Sicherheit für Israels
Bestreben, sich vor Terrorismus zu schützen, begründen. Aber ich konnte
mich nicht einmal mich selbst davon überzeugen, dass diese Gründe gut
genug waren. Ich war erschöpft und wünschte, ich wäre woanders."
Miriam K. und ihre Gesprächspartner, zu denen auch Sami
Adwan gehörte, erlebten auch, wie aus dem gegenseitigen Zuhören, dem
Aushalten und Ausdrücken der eigenen Schmerzen, ein neues gegenseitiges
Verständnis erwuchs: „Als die Tage verstrichen und wir mehr und mehr
schreckliche Geschichten von allen Seiten hörten, fühlte ich, dass die
Mauern zu brechen begannen. Wir weinten gemeinsam, trösteten einander
und fühlten, dass wir dabei waren, Brücken zu errichten." Ein
Verständnis, das zunächst äußerst fragil war und durch die Frage einer
Palästinenserin, die die Realität des Holocaustes in Frage zu stellen
schien, wieder zu zerbrechen drohte. Martin Bormann wurde nun mit seiner
Geschichte zum glaubwürdigen Zeitzeugen: „Die Palästinenser hörten ihm
offensichtlich gebannt zu. Die ganz Situation war unwirklich: Juden
versuchten, Palästinenser von der Bedeutung und Wahrheit des Holocaust
zu überzeugen, während der Sohn eines berühmten Nazi-Täters die Fakten
aufzählte." Mehr als ein Jahr nach dem Hamburger TRT-Dialog, reflektiert
Miriam K. ihre Erfahrung so: „Noch einmal war meine Weltsicht
erschüttert worden. Meiner Ansicht nach waren Juden immer die Opfer,
aber diese Position kann ich nun nicht mehr aufrecherhalten. Der
Workshop in Hamburg hat mich aus dieser Opferkategorie
herauskatapultiert, und ich musste mir einen neuen Platz suchen. Ich bin
unserer Konfliktgruppe für den Mut und die Offenheit, ihren Schmerz
mitzuteilen, sehr dankbar. Sie ging mit unbequemen Tatsachen um und ließ
neue Informationen an sich heraus, die für sie eine Herausforderung
darstellten."
Die Palästina-Israel-Gruppe war sicher die schwierigste
der Hamburger Begegnung. Doch die praktischen Konsequenzen, die daraus
erwuchsen, haben bis heute Bestand: Aus der persönlichen Begegnung von
Sami Adwan und Dan-Bar On wurde die Idee für „PRIME – Peace Research
Institute for the Middle East", geboren. Die Forschungsprojekte dienen
dazu, die gemeinsame Zukunft von Palästinensern und Israelis in der
Region vorzubereiten. Auch unter den schwierigen, kriegsähnlichen
Bedingungen arbeiten sie weiter an den gemeinsamen Projekten und halten
den Kontakt untereinander aufrecht. Für den Würzburger Kongress hatte
Sami Adwan erstmalig wieder eine Ausreisemöglichkeit erhalten. Er
berichtete den Zuhörern, wie er während der ersten Intifada, im
israelischen Gefängnis zum erstenmal begann, hinter der Maske des
Feindes, die Gesichter von Menschen wahrzunehmen und wie ihn das bewog,
auf Gewalt als Mittel Konfliktlösung zu verzichten.
Dan Bar-On versteht den TRT-Prozess als Möglichkeit, an
der langfristigen Befriedung von ethnischen, nationalen und religiösen
Konflikten zu arbeiten. Gerade auch solche, die auf der
legal-juristischen Ebene gelöst erscheinen, wie z.B. in Nordirland oder
Südafrika, existieren die Folgen der jahrzehntelangen Gewalt weiter und
haben eine subtile Wirkung: „Konflikte verändern sich auf der
offenkundigen Ebene, aber das bedeutet nicht notwendigerweise eine
Schwächung der Motive; vergessen geglaubte Konflikte können wieder
aufflammen." Als Beispiel führt der Forscher die ethnische Konflikte auf
dem Balkan an: oberflächlich schienen frühere ethnische Spannungen im
kommunistischen Jugoslawien aufgehoben, was eine Rate von 46% ethnisch
gemischter Ehen zu belegen schien. Doch die Auflösung der jugoslawischen
Zentralmacht nach der Wende ließ die alten Spannungen wieder an die
Oberfläche kommen und in extremes Blutvergießen eskalieren - sogar
zwischen vertrauten Nachbarn und guten Bekannten. Daran wird deutlich,
so Dan Bar-On, dass die Konflikte auf der oberflächlichen Ebene
unterdrückt wurden, doch in psychologischer Hinsicht keine Verarbeitung
stattgefunden hatte. „Diesem verborgenen Aspekt muss sich eine
psychosoziale Schlichtungsstrategie, wie z.B. der TRT-Prozess, widmen,
damit eine dauerhaft erfolgreiche Konfliktlösung möglich wird
Elisabeth Gruendler
Dan Bar-On, Sami Adwan und Martin Bormann sind am 21.
Febr. 2002 in Berlin und stellen dort den TRT-Prozeß vor. Ort:
Katholische Akademie Berlin, Hannoversche Straße 5 (Mitte), U 6
Oranienburger Tor. Zeit: 19.00 - 21.30 Uhr.
Eine gekürzte Fassung dieses Beitrags wurde in
Psychologie heute, Okt. 2001 veröffentlicht.
hagalil.com / 18-02-02
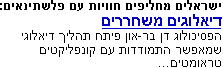
haGalil onLine 18-02-2002 |