|

Die Stille des Kibbuzes von Lotan:
In aller Ruhe die Welt verbessern
Es gibt keine Disco, keine
Filme, keinen Supermarkt, aber auch keine Terroristen und
Attentäter: Das Leben in einem ganz anderen Paradies
Von Thorsten Schmitz
Lotan, im Juli – David Schoneveld fliegt an
diesem Samstag erst zum zweiten Mal in seinem Leben einen Jumbojet
vom Typ Boeing 747, er ist kaum ansprechbar. Er knabbert an der Haut
um die Fingernägel, fixiert die Instrumente im Cockpit, lauscht den
Anweisungen der Bodenkontrolle des internationalen Flughafens von
Los Angeles. Der Fluglotse im Tower bittet World Traveller mit der
Flugnummer 079 zur Startposition. Die Flugzeit bis nach San
Francisco wurde mit 47 Minuten berechnet. Die Maschine ist voll
beladen, also schwer. Schoneveld startet die vier Triebwerke und
gibt nach dem Okay aus dem Tower Schub.
Der Jumbojet braucht die gesamte Länge der
Startbahn, bis sich seine Nase in den wolkenlosen Himmel bohrt.
Innerhalb weniger Minuten erreicht das Flugzeug die vorgeschriebene
Flughöhe von 33000 Fuß, Schoneveld korrigiert Richtungsmesser und
Parameter für den bordeigenen Radar, er lächelt. Unter ihm liegt Los
Angeles, die Lego-Stadt, links brandet der stahlblaue Pazifik an
Kaliforniens Küste, aus dem Kopfhörer dringen Wortfetzen aus
Buchstaben und Zahlen.
David Schoneveld lehnt sich zurück, nippt an einem
Glas Wasser und reibt sich die Hände, als die Haustür geöffnet wird.
Seine Frau Leah Benamy kommt vom Kühemelken, sie ist Schweiß
überströmt, rot im Gesicht, lässt sich in den Wohnzimmersessel
fallen und zieht Schuhe und Strümpfe aus. Üblicherweise würde David
seiner Frau Leah, einer Rabbinerin, einen kalten Saft bringen, aber
er muss ja nach San Francisco fliegen, also holt sie ihn sich
selbst. David Schoneveld ist 39 Jahre alt und hat eine Begeisterung
fürs Fliegen, die noch nicht mal seine beiden Söhne Shay und Ayal
teilen. Ihnen ist das Instrumentenwirrwarr auf dem
Computerbildschirm zu kompliziert, sie spielen lieber Gameboy oder
ärgern ihre dreijährige Schwester Naama.
Der Screensaver auf David Schonevelds
Computerbildschirm besteht aus drei Verkehrsflugzeugen, die auf
Startfreigaben warten. Er hat einen wöchentlichen Newsletter
abonniert, in dem über neue Flugzeugtypen, Abstürze und Flughäfen
berichtet wird, und er fliegt, "wann immer ich kann" – als
Passagier, nicht als Pilot. Was vermutlich sicherer ist, denn wir
hier vor dem Computer überleben den Flug nach San Francisco nicht
und stürzen ab, wofür sich David, der mal drei Jahre lang Steward
bei USAIrways war, entschuldigt: "Die Maschine war verdammt schwer
zu lenken."
David Schonevelds Flüge sind kleine Fluchten aus
der überschaubaren Welt von Kibbuz Lotan in die ungeordnete da
draußen. Anstatt zu fliegen, schält er sich jeden Morgen um 4.40 Uhr
aus dem Bett und schweißt von 5 Uhr an Kuhställe,
Traktoraufhängungen, Autoachsen. Die Computerflüge sind
erschwinglich für David Schoneveld und seine Familie, er und seine
Frau Leah erhalten monatlich umgerechnet 350 Euro plus Zulagen für
die drei Kinder. Flüge zu Leahs Familie in New Jersey allerdings
sind höchstens alle zwei Jahre drin.
Die große weite Welt, die David Schoneveld per
Newsletter abonniert hat und die sich auf seinem Computerbildschirm
abspielt, ist in Lotan sehr fern. Der Kibbuz könnte genauso gut ein
Stadtteil vom Mond sein. Lotan liegt fünf Autostunden südlich von
Tel Aviv an der Grenze zu Jordanien, ein Werktag unterscheidet sich
hier kaum vom arbeitsfreien Schabbat: Es ist paradiesisch ruhig. Für
die 70 Erwachsenen und 70 Kinder und Jugendlichen stehen sechs Autos
zur Verfügung, also fehlen Verkehrsgeräusche. Vögel hört man,
Kinderlachen, eine jüdische Touristengruppe aus London, die den Trip
in die Wüste als Abenteuer verbucht. Ansonsten: Stille, Stille,
Stille. Wenn man morgens um sieben den Swimmingpool betritt, ist man
mit den Vögeln allein, die vom Beckenrand am Wasser nippen, es gibt
keine Disco, keinen Pub, keine Filmvorführungen, keinen Supermarkt.
Nur Schreie von Fußballern sind zu hören an Samstagnachmittagen. In
Lotan wird jeden Samstag Fußball gespielt, wenn es nicht heißer als
45 Grad ist.
Leah Benamy fährt alle paar Wochen für einen
ganzen Tag ins 50 Kilometer entfernte Eilat am Roten Meer und
erfüllt die Wünsche ihrer 139 Nachbarn, kauft Tampons, Cola,
Videokassetten, Kondome, lässt Bilder entwickeln, reicht Schecks bei
Banken ein, besorgt Hundefutter und Pudding. Das Leben in Lotan ist
zurückgeschraubt auf Essenzielles, auf drei Mahlzeiten im Speisesaal
in "downtown" Lotan, wie die Einwohner selbstbewusst das
Kibbuzzentrum nennen, auf Mahlzeiten aus ökologischem Anbau, auf
Salate, Käse, Gemüse, auch auf Fleisch, aber wenn, dann nur Huhn,
und für Vegetarier Quiches oder Süßkartoffeln mit Bohnen.
Sparglühbirnen überall, keiner raucht, Alkohol ist
verpönt, es gibt einen Gemüsegarten mit Kompostklo, den man "Zentrum
für kreative Ökologie" getauft hat und wo ein Regenwald entstehen
soll. Eine Vogelbeobachtungsstation haben sie mitten in die Wüste
gepflanzt, weil Lotan in der Haupteinflugschneise liegt, wenn im
Frühjahr und Herbst die Zugvögel aus Osteuropa in den Süden fliegen
und wieder zurückkehren.
Magische Kraft
Ein ganzheitliches alternatives Gesundheitszentrum
wird gerade in umweltgerechter Lehm-Stroh-Weise errichtet. Müll wird
getrennt (was in Israel keiner tut), nur die Antenne der Handyfirma
am Rande Lotans ist manchem ein Dorn im Auge, andererseits zahlt
Cellcom dem Kibbuz rund 50000 Euro im Jahr Pachtgebühr.
Lotan hat eine selbst auferlegte Berufung: Der
Kibbuz, 1984 von 40 Reformzionisten aus Israel und den USA ins
Arawa-Tal in die südliche Negev-Einöde gepflanzt, will die Welt
verbessern. Wirtschaften tut der Kibbuz mit Dattelpalmen und
Milchvieh, Missionieren will er außerdem. So steht es in einer
"Absichtserklärung", die jeder Bewohner unterschreiben muss.
Zwei Jahre wurde in Vollversammlungen um die acht
Thesen gerungen, ein Drittel der Bewohner verließ in dieser Zeit
Lotan, die meisten blieben, weil sie an Ideale glauben. Daran etwa,
dass es möglich sei, in Einklang mit der Natur, der Wüste, zu leben,
daran, dass jede Person den gleichen Wert besitze und mit Respekt
behandelt werde, an "Tikun olam": "Wir arbeiten an der Verbesserung
unserer selbst, unseres Volkes und der Welt." Vor lauter Harmonie
bin ich am zweiten Tag meines Aufenthalts in mein Auto gestiegen und
eine halbe Stunde in ein Einkaufszentrum nahe Eilat gefahren für
einen Capuccino und den Versuch, wieder Kontakt aufzunehmen mit dem
wahren Leben. Ich trank den Kaffee allerdings nicht aus und wollte
schnell wieder zurück nach Lotan.
Für ihre Mission haben sich die Kibbuzniks einen
Ort ausgesucht, von dem die zu verbessernde Welt so weit entfernt
liegt, dass diese von Lotans Verbesserungsbemühungen nichts oder
höchstens über deren Website etwas mitbekommt (http://www.kibbutzlotan.com).
Schon bei der Autofahrt durch Wüste und an Kamelherden vorbei werden
die Probleme, die auf Israel lasten, immer kleiner, immer leichter,
immer verschwommener. Die Wüste hat eine magische Kraft, die Codes
aus den Städten zu eliminieren – auch die Angst und die Bedrohung.
In Lotan habe ich drei Tage lang dasselbe T-Shirt getragen, dieselbe
kurze Hose, hässliche, aber bequeme Birkenstocksandalen. Auch die
Gedanken an den Nahost-Konflikt, an Terroristen, an
Selbstmordattentäter verpuffen. Lotan ist Teil Israels, aber
irgendwie auch nicht.
Das Wort Palästinenser fällt in den drei Tagen
meines Aufenthalts genau dreimal und auch nur, weil ich das Gespräch
darauf gelenkt habe. Generell wollen die Lotaner Frieden mit den
Menschen, der Natur, den Tieren und sowieso alle Kriege von der Welt
verbannen, wozu auch der vor der eigenen Haustür gehört. An den
Freitagabenden versammeln sie sich im Gemeinschaftssaal und begrüßen
den Schabbat, beten und singen und zitieren aus der Bibel und
summen, dass Gott einen "wundervollen Platz aus der Erde" erschaffen
möge ohne Blutvergießen. Erfüllt von Harmonie oder der Sehnsucht
nach ihr, umarmen sich die Männer und Frauen nach dem Beten und
wünschen sich einen guten Schabbes.
Leah Benamy hat das Prinzip Lotan an diesem Abend
auf dem Weg zum Speisesaal ganz einfach so erklärt: "Anstatt auf den
Messias zu warten wie die Orthodoxen, dass dann mit seiner Ankunft
alles besser werde, versuchen wir jetzt schon, alles besser zu
machen." Mit mehr oder weniger Erfolg. Ihr achtjähriger Sohn Shay
nahm an diesem Abend weder am Beten teil, noch kam er in den
Speisesaal, weil er von einem Gameboy fasziniert ist, den ihm –
gegen Leahs Willen – die Oma aus Amerika geschenkt hat. "Ich hätte
lieber, dass Shay seine sozialen Fähigkeiten entwickelt, als sich
mit seinem Gameboy zurückzuziehen", seufzte Leah Benamy. Und ihr
Ehemann, David Schoneveld, sagt: "Der Nahost-Konflikt spielt in
unserem Alltag eher keine Rolle. Wir leben hier in einer
Seifenblase." Drei Kinder, einen Job als Schweißer, Melkdienste im
Kibbuz-Kuhstall, die Passion fürs Fliegen, "da bleibt keine Zeit für
Zeitungen", sagt er. Sowieso sind im Kibbuz nur zwei Radiosender zu
empfangen, und Kabelfernsehen ist den meisten zu teuer.
Im Rest des Landes patrouillieren Soldaten an
Stränden und vor Einkaufszentren, kontrollieren Wachmänner die
Taschen vor Clubs und Bars und Fitnessstudios, in Lotan gibt es zwei
junge israelische Soldaten, die in einem Wohnwagen sitzen neben
einer Wassertankattrappe. In dem hohlen Wassertank befindet sich
eine Sensorkamera, die die Grenze zu Jordanien filmt. In den letzten
zwanzig Jahren waren die einzige Gefahr, die von Jordanien ausging,
mehrere Kamele jordanischer Beduinen, die sich im Grenzgebiet
verirrt hatten und an Lotans Vogel-Biotop aus Büschen und Bäumen
naschen wollten. Wenn der Begriff nicht so abgedroschen klänge,
müsste man jetzt schreiben, dass Lotan eine Insel des Friedens sei.
Leah Benamy nickt, als sie eine Mango schält und
versucht, drei Kinder im Zaun zu halten: "Insel des Friedens klingt
gut, es wäre aber noch besser, wenn es hier auch Bananenshake mit
Schokosplitter gäbe." Wenn man die Menschen in Lotan fragt, was sie
vermissen, findet jeder gleich eine Antwort, wobei niemand Regen
vermisst, obwohl es im Jahr höchstens sechsmal regnet. David
Schoneveld etwa hätte gerne einen großen Airport vor der Tür, Leah
Benamy sagt, sie würde gerne shoppen, Jochi Schweitzer und ihr
Freund Gil Segev sagen: "Wir vermissen Sushi und Hamburger."
Die beiden sind ein Paar, aber nicht verheiratet
und erst vor vier Monaten nach Lotan gezogen. Die Umstellung war
groß, sie fing schon bei der Ankunft an: "Wir mussten unser Auto
abgeben." Das heißt, es steht jetzt bei den Eltern von Jochi, die es
verkaufen sollen. Jochi und Gil sitzen in ihrem kleinen Wohnzimmer
mit den schicken Möbeln aus ihrem früheren Leben aus Herzliya, dem
Starnberg von Tel Aviv, und lassen die ersten Wochen Revue
passieren, während es sich der weiße Hund, der Schnee heißt, im
kalten Strahl der Klimaanlage bequem macht. Gil ist 29 Jahre alt,
Jochi 28, und beide hatten, so sagen sie, ein perfektes Leben, also
Arbeit, Wohnung, Freunde, Abends essen gehen oder ins Kino. "Aber
irgendwann", sagt Jochi, "kam uns unser Leben so banal und
oberflächlich vor". So hing Jochi ihren Job bei einer Handyfirma an
den Nagel und schnippelt jetzt Gemüse in der Kibbuzküche. Gil hatte
seinen Beruf als Computerprogrammierer sowieso satt, jetzt züchtet
er Fische in der Bucht von Eilat, taucht tagsüber im Roten Meer, und
wenn er abends von Eilat zurückkehrt, dreht er vielleicht noch ein
paar Runden im Kibbuzpool. Schön sei die Gewissheit, ökologisch
bewusst zu leben, komisch das neue spartanische Leben, sagen beide.
Jochi hat bis heute kein einziges Lied von Madonnas neuer CD gehört,
aber "ich vermisse das auch nicht".
In Herzliya komme man an neuen Liedern gar nicht
vorbei, ständig spielt das Radio irgendwo, Leuchtreklame und MTV in
den Cafés. Für Gil ist das Essen eine Umstellung. Früher fuhr er von
der Arbeit am Abend an "18 Restaurants" vorbei, heute kommt er in
Lotan in den Speisesaal – wo es ökologisch korrekte Salate gibt.
Auch das Aufstehen ist noch immer eine Zumutung. In Herzliya
schälten sie sich um 8 Uhr aus den Federn, verließen um 9 das Haus,
und auf dem Weg zur Arbeit (in zwei Autos) stoppten sie irgendwo und
kauften einen Kaffee "To go". In Lotan stehen beide um halb sechs
auf, wenn die Sonne noch nicht so knallt. Die Gemeinschaft lieben
sie, sagen beide, und dass jeder für jeden da sei. Gil wird in Lotan
sehr geschätzt, er repariert Computer, mit denen die Lotaner den
Kontakt zur Außenwelt aufrecht halten – was Gil jedoch nicht davon
befreit, an manchen Samstagen wie alle anderen auch die Kühe zu
füttern und zu melken. Die Tel Aviver Freunde von Gil und Jochi
haben sich an den Kopf gefasst und gefragt, ob sie noch ganz dicht
seien, Wohlstand, Karriere und Sicherheit aufzugeben. Jochis Mutter
weigert sich, Lotan überhaupt aufzusuchen, bevor die beiden
geheiratet haben, ihr Vater dagegen war schon da und findet seine
Tochter mutig.
Die Geliebte will nicht
Die Seele des Kibbuzes heißt Michael Livni, ist 68
Jahre alt und kann nur lächeln über die Sehnsüchte seiner Nachbarn
nach Sushi und Hamburgern. Früher oder später musste ich Livni
begegnen, ich bin ihm früh begegnet, und das war gut so. Livni ist
geschieden, seine Kinder leben in den großen Städten Israels, er hat
eine Fern-Beziehung mit einer Australierin, die beiden reden jeden
Samstag um halb zehn Uhr morgens am Telefon miteinander. Bei den
Gesprächen versucht Livni seine Geliebte jedesmal zu überreden, doch
nach Lotan zu ziehen.
Seit vier Jahren tut er das. Wie ein Bürgermeister
wirkt Livni, wobei es in einem Kollektiv wie Lotan
selbstverständlich keine Bürgermeister gibt. Michael Livni hat das
Kibbuz mit gegründet, ist in Wien geboren, hat als Arzt gearbeitet,
als Lehrer, Truthahnzüchter, leitender Funktionär der Jewish Agency,
Zitrusplantagenaufseher, jetzt ist er für den Tourismus in Lotan
verantwortlich. Er hat alle Diskussionen in all den Jahren
mitgemacht und vermutlich nicht eine der drei Mahlzeiten im
Speisesaal verpasst. Zu Hause hat er eine kleine Küche, in der er
einen köstlichen Eiskaffee servierte und den Besucher mit Vorträgen
und Analysen zudeckte, die er selbst verfasst hat. In ihnen hat er
alle soziologischen Aspekte des Kibbuzlebens durchleuchtet,
gegeneinander abgewogen, zusätzlich hat er drei Bücher verfasst, die
man auch über amazon.com bestellen kann. In den Pool geht er kaum
noch, aber in die Vogelbeobachtungsstation.
An einem Morgen verabreden wir uns um sechs Uhr
(was in der Wüste eine zivile Zeit ist), und Livni führt mich zwei
Stunden lang durch die Wüste und die Vogelhaine. Er fotografiert die
Spuren im Sand von Füchsen und Gämsen und Schlangen und Echsen, er
stellt das Fernglas scharf, doziert über tektonische
Wüstenplattenverschiebungen und über afrikanische Bäume, die ohne
Wasser in der Wüste anfangen zu blühen. Livni möchte an keinem
anderen Ort der Welt leben, bestimmt fließt in seinen Genen längst
Lotan. Er ist der Einzige, der auf die Frage, was er vermisse, mit
einer Pause reagiert, und dann sagt, er vermisse nichts. Sogar seine
Lieblingszeitschrift, ein politisches Magazin aus Indien, erreicht
die Öko-Oase: "Ich bin vermutlich deren einziger Abonnent in
Israel." Das tägliche Abstimmen mit den anderen, das
Rücksichtnehmen, Zuhören, Miteinanderzurechtkommen, das Streiten,
Ändern, Kompromisse finden ist Livnis Lebensinhalt wie der der 139
anderen in Lotan. Der Konflikt mit den Palästinensern sei "ganz weit
weg", sagt Livni und knabbert an einem Stück Mohnkuchen. "All unsere
Energie fließt in die Gemeinschaft, da bleibt nicht mehr viel Kraft
übrig für den Nahost-Konflikt."
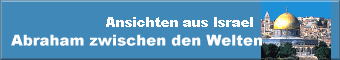
hagalil.com
28-07-03 |