|

Manche israelischen Soldaten leiden selbst unter dem, was sie
den Palästinensern antun: "Ich bin noch heute wie gelähmt"
Zerbrechen an der eigenen Stärke
Verwundete, deren Wunden man nicht sieht – wie
frühere Angehörige einer Eliteeinheit ihren harten Einsatz in den besetzten
Gebieten verarbeiten
Von Thorsten Schmitz
Tel Aviv , im November – Von Israel aus betrachtet, hat sich
Omri vor acht Jahren auf eine Reise ans Ende der Welt begeben, und es sieht so
aus, als bliebe er dort. In Seattle, im äußersten Nordwesten der USA, trennen
ihn zehn Zeitzonen und 17 Flugstunden von Tel Aviv. 12000 Kilometer liegen
zwischen seiner olivgrünen Uniform, der Vergangenheit – und seinem Sakko, der
Gegenwart.
Die israelische Sonne vermisst der Computerspezialist in den
langen Wintermonaten in Seattle, das Hebräischsprechen und vielleicht noch einen
guten Falafel-Imbiss. Und sonst?
"Nichts."
Was nicht ganz stimmt, denn in Wahrheit muss Omri, der seinen
Familiennamen nicht nennen will, auch im fernen Seattle auf das verzichten, was
ihn dazu bewegt hat, der Heimat den Rücken zu kehren: eine innere
Ausgeglichenheit. Nächte ohne Alpträume, Tage ohne Versprecher. Letzte Woche
trieb der Hunger Omri in einen Falafel-Laden in Downtown Seattle. Dort verlangte
er vom palästinensischen Imbissbesitzer auf Hebräisch, dieser solle sich
ausweisen. Die arabischen Schriftzeichen, der Geruch von Humus, das Bild vom
Felsendom in Jerusalem über der Fritteuse hatten Omri in die Vergangenheit
katapultiert.
Zwei Nächte lang konnte er nicht einschlafen, tagsüber ertappte
Omri sich dabei, wie er regungslos auf den Computerbildschirm starrte und den
Kampf in seinem Kopf gegen die Bilder aus der Vergangenheit verlor. Wenn er von
der Arbeit nach Hause kam und seinen Sohn mit Harry Potter in den Schlaf las,
hoffte Omri, seinem Sohn möge die Armee erspart bleiben. Und also die Scham, die
auf dem Vater lastet, seitdem der die Uniform an den Nagel gehängt hat.
Mit toten Fledermäusen
Mit 20 Jahren, in einer Elitekampfeinheit der israelischen Armee
in den besetzten Palästinensergebieten, "war mein Gewissen unausgereift", sagt
Omri heute als 31-Jähriger. Töne waren von ihm zu hören, über die er heute
entsetzt ist. Die Angst vor der Intifada und davor, bei der Verteidigung der
Heimat mit der Waffe in der Hand zu versagen, kaschierte Omri damals mit starken
Sprüchen: "Wenn ich einen Palästinenser erwische, der Steine nach mir geworfen
hat, wird der ganz klein. Er beginnt zu weinen, und dabei fühle ich mich gut.
Ich habe dann Kontrolle über ihn."
Diese Sätze sprach Omri vor zehn Jahren in die Kamera seines
Armeekollegen Jarif Horowitz, der im Auftrag der Armee einen Film drehen sollte
über die Stimmung junger Soldaten in Nablus während der ersten Intifada.
Stoischen Blicks berichtet Omri darin von Vorgesetzten, die den jungen Rekruten
in Plastiktüten tote Fledermäuse überreicht hätten mit der Aufforderung, damit
die Menschen in den besetzten Gebieten einzuschüchtern. "Wir waren von der
Intifada überrascht, es gab keine Lösungen und keine konkreten Vorschriften, wir
mussten improvisieren. An einem Ort voller Gewalt und Macht wirst du als Soldat
sehr kreativ..."
Omri ist seit zwei Jahren das erste Mal wieder in Israel, um
seine Eltern zu besuchen. Die Freunde von der Armee meidet er. Der Filmemacher
Horowitz hat ihn eingeladen, spielt ihm die Sätze von damals in seinem
Wohnzimmer in Tel Aviv vor. Fassungslos blickt der 31-jährige Omri auf den 20-
jährigen Omri und sagt: "Das war nicht ich, der da gesprochen hat."
Der Filmemacher Horowitz hatte damals als Soldat in der
Lehrabteilung der Armee den Auftrag, einen Film zu drehen, der die Soldaten in
den Palästinensergebieten aufmuntern und ihnen die Angst nehmen sollte. Alle
zehn Soldaten, mit denen Horowitz damals sprach, waren Mitglieder einer
Eliteeinheit, "Melach Ha‘aretz" genannt, Salz des Landes. Doch die Gespräche mit
Soldaten wie Omri verliefen bereits in den ersten Minuten nicht wie geplant. Die
Soldaten berichteten von orientierungslosen Kommandeuren, die von dem Ausbruch
der Gewalt der Palästinenser ebenso überrascht worden waren wie das politische
Establishment.
Die Hilflosigkeit und die fehlende Zurückhaltung der Vorgesetzten
übertrug sich auf die jungen Soldaten. Horowitz ließ in seinem Film den damals
20-jährigen Ilan zu Wort kommen: "Ich renne fünf Minuten hinter dem
Palästinenser her, mit meiner kiloschweren Ausrüstung in glühender Hitze. Ich
schwitze und bin müde, und wenn ich ihn erwische, bin ich wütend auf ihn, weil
ich ihm hinterherrenne und er Steine nach mir wirft und weil ich in Nablus sein
muss. In dem Moment empfinde ich nur Wut, die ich an ihm auslasse. "
Zehn Jahre später sind die meisten Soldaten aus der ersten
Intifada, wie Omri etwa, die Zeit in den Palästinensergebieten immer noch nicht
los. Zehn Jahre nach Abgabe ihrer Uniformen leiden sie unter Schlaflosigkeit
oder periodisch wiederkehrenden Alpträumen, in denen geschossen und gebombt
wird, in denen Palästinenser und Soldaten bluten und sterben. Manche, wie Omri,
sind vor der Heimat und den Erinnerungen ins Ausland geflüchtet, andere, wie
Ilan, in Israel geblieben und haben ihr Leben völlig geändert. Vor zehn Jahren
war Ilan wild entschlossen, den Aufstand der Palästinenser zu brechen. Heute
lebt er zusammen mit seiner Frau und seinen zwei kleinen Söhnen im Norden
Israels auf einer Hippiefarm in atemraubender Natur und schämt sich.
Ein anderer Mensch
Der 30-Jährige, der ebenfalls nur seinen Vornamen nennt, trägt
weite T-Shirts und Stoffhosen aus Nepal, das Haar reicht ihm bis über die
Schultern, er sitzt in seinem Obst- und Gemüsegarten und raucht am späten
Vormittag einen Joint und erzählt, wie die Armee damals in den drei Jahren
Dienst aus ihm einen anderen Menschen gemacht habe: "Ich war nach der Armee
voller Aggression. Ich bin nach Hause zu meinen Eltern gekommen, habe alle Möbel
verrückt, Porzellan zerbrochen, Vorhänge heruntergerissen und sie angebrüllt
‚Seht, das ist eine ordentliche Hausdurchsuchung!’ – Ich bin total ausgerastet."
Aus nichtigen Anlässen habe er sich mit anderen geschlagen, erzählt er, gebrüllt
und gestänkert habe er. Ilan lebt jetzt ohne Armbanduhr und ernährt sich vom
Verkauf seiner Obst- und Gemüseernte. Das bislang Aufregendste in seinem
ansonsten ereignisarmen Leben war das Zähnekriegen seines Sohnes. Er steht auf
einem Hügel, von dem er das nördliche Galiläa nahe dem See Genezareth überblickt
und sagt: "Wer seine Impulse zu beherrschen weiß, ist ein wahrer Held. Damals
haben mich meine Impulse beherrscht." Mitleid für die jungen Soldaten und
Soldatinnen, die gegen die Akteure dieser zweiten Intifada eingesetzt sind, hat
Ilan bereits jetzt: "Wir schicken unsere Kinder in den Krieg, und auch wenn wir
stärker sind als die Palästinenser, bleiben Wunden unser Leben lang."
Ilan, Omri und all die anderen Elitesoldaten sind in den letzten
zehn Jahren in psychologischer Behandlung gewesen, manchmal über Jahre hinweg.
Chaim zum Beispiel, ein heute 30-jähriger Familienvater und Nachbar von Ilans
Gemüsefarm, gibt freimütig zu, dass damals Palästinenser fast zu Tode geprügelt
worden seien, "einfach so. Manchmal sind wir Steinewerfern hinterhergerannt,
haben sie gefangen genommen und dann, wenn dein Vorgesetzter anfängt
draufloszuschlagen, dann tust du es ihm gleich." Seit zehn Jahren trägt Chaim
eine Schuld mit sich herum, "die mir niemand nehmen kann".
Die Worte der vergessenen Kinder Israels werfen ein Schlaglicht
auf eine Generation, die kurz nach der Schule in Uniformen gesteckt wird und mit
Waffen ihre Heimat verteidigt. Und wie in allen Armeen dieser Welt zieme es sich
auch in der israelischen nicht, Schwächen und Ängste zu zeigen, erklärt Dr.
Joram Juval, ein Psychiater und Psychoanalytiker aus Tel Aviv, der
traumatisierte Soldaten zu seinem Patientenstamm zählt.
Der Armee ist das Thema offenkundig unangenehm. Ehud Knobler, der
Chef der Trauma-Abteilung der Streitkräfte, sucht die Zahl der traumatisierten
Soldaten kleinzureden: Sie sei "signifikant" niedriger als die unter Soldaten
der UNO etwa. Dr. Juval dagegen sagt, viele Soldaten litten nach ihrer Zeit bei
der Armee unter posttraumatischem Stress, der sich in Alpträumen, Hyper-
Stresssymptomen wie Aggressionen und Schlaglust, auch Drogenkonsum äußere. Mit
Hasch und Ecstasy flüchteten viele Ex-Soldaten in eine "friedliche Welt, in der
es keine Intifada gibt". Manche Soldaten seien derart von schlechtem Gewissen
gemartert, dass sie auch tagsüber Erlösung in Wasserpfeifen und Joints suchten.
Und manche bleiben daran hängen. Eine halbe Autostunde von Tel
Aviv entfernt befindet sich Kfar Isun, das "Dorf des Gleichgewichts". Es ist ein
offenes Camp für globetrotternde Ex-Soldaten, die auf ihren Indien- und
Nepaltripps nach der Armee-Zeit auf Drogen hängen geblieben sind, oder für
Soldaten, die den Anblick von Leichen im Westjordanland und das eigene Töten
psychisch nicht verkraftet haben.
Das Dorf ist ein Heilungsort für Verwundete, deren Wunden man
nicht sieht. Geleitet wird es vom früheren Offizier Omri Perisch und einem Team
aus Psychologen, Sozialarbeitern, Therapeuten und der ehrenamtlich arbeitenden
Frau von Verteidigungsminister Schaul Mofaz. Zur Zeit halten sich dort etwa 120
israelische Jugendliche auf, manche nur tagsüber, manche auch in der Nacht. Es
ist eine Insel der Friedfertigkeit, ohne Checkpoints und Armeestützpunkte, ohne
schusssichere Westen, militärische Befehle, Hausdurchsuchungen, Schüsse.
Die Vögel hört man in Kfar Isun, das Meeresrauschen und von ganz
weit weg den steten Verkehr auf der Küsten-Autobahn. Fernsehen ist verpönt, denn
man stößt auf allen Kanälen auf Berichte über die Intifada und ihre Opfer.
Stattdessen vertreibt man sich die Zeit mit Musik, Schiazu- und
Fußreflexzonenmassage. Die Ex-Soldaten sprechen mit Therapeuten, lassen Drachen
steigen, machen Musik und studieren Theaterstücke ein.
Gedanken an Selbstmord
Jonathan sitzt auf den Stufen der Treppe zum Massageraum und
raucht eine Zigarette. Er gehörte der Elitetruppe "Duvdevan" (Kirsche) an, einer
Kampfeinheit, deren Mitglieder sich als Palästinenser verkleiden und sich in den
Städten der autonomen Palästinenser-Gebiete unters Volk mischen. Sie sprechen
arabisch, haben eine palästinensische Vita auswendig gelernt, falls jemand in
Ramallah, Tulkarem oder Nablus Verdacht schöpfen sollte, und sie nehmen
potenzielle Selbstmordattentäter fest.
Jonathan ist an seiner Aufgabe zerbrochen: "Irgendwann musste ich
mir eingestehen, dass ich nicht über die Stärke verfüge, die ich nach außen hin
gezeigt habe." Zusammen mit seinen Kameraden sei er in Häuser eingedrungen bei
Nacht unter den angstvollen Blicken der Kinder in ihren Pyjamas, erzählt der
junge Mann, "wir haben Zivilisten getötet, und ich habe mir immer gesagt,
‚Jonathan, du machst nur deine Arbeit’. Meine Vorgesetzten haben mir versichert,
man könne abschalten, das Undercoverleben könne mir nichts antun." Doch eines
Tages brach Jonathan zusammen, wurde vom Dienst befreit, heulte sich beim
Militärpsychologen aus. "Es tut mir sehr leid, was ich anderen Menschen angetan
habe an Verletzungen. Ich bin wie gelähmt, sitze zuhause, blättere in
Comic-Heften, habe nichts zu tun." In Kfar Isun lerne er, sich selbst
kennenzulernen, erzählt er.
Der Leiter des Dorfes, Omri Perisch, sagt: "Vor zwei Jahren
hatten wir nur Rucksacktouristen, die auf ihren Reisen zwischen Armee und
Universität auf Drogentripps hängen geblieben waren. Seit Beginn der Intifada
kommen mehr und mehr Soldaten zu uns, die den Krieg vor der Haustür nicht mehr
verkraften. Manchmal rufen uns Eltern an und berichten, dass sie ihre Söhne
nicht wiedererkennen. Dass sie aggressiv geworden sind, oder apathisch in ihren
Zimmern liegen oder von Selbstmord reden." In Gesprächen mit den Soldaten hört
Omri Perisch oft den Satz: "Ich habe das nicht getan, jemand anderes in mir war
das."
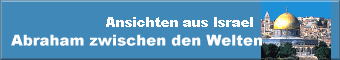
hagalil.com
25-07-02 |