|
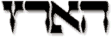
Fischer:
Trotz meiner Bemühungen verschlechtert sich die Position Israels in
Europa
In Haaretz schreibt Aluf Ben zum
Besuch des deutschen Außenminister, Joschka Fischer, der Anfang April
2003, nach einer Abwesenheit von zehn Monaten, zu einem erneuten Besuch
nach Israel und in die PA kam.
Bei seinem Gespräch mit AM Silvan Shalom
warnte Fischer vor einer Verschlechterung der Position Israels in Europa
und sagte, er könne die Sorge um Israel auf dem Kontinent nicht „auf
seinen Schultern tragen“. Er rief Shalom auf, sich um eine Verbesserung
der Beziehungen zu Europa zu bemühen. Shalom sagte, die Förderung der
Beziehungen zu Europa sei seit seinem Amtsantritt eines seiner zentralen
Ziele, in Israel herrsche jedoch die Annahme vor, die Europäer seien
pro-palästinensisch und anti-israelisch.
Shalom sagte, der Krieg in Irak sei wichtig, Israel sei jedoch kein Teil
dieses Krieges und distanziere sich von einem „Linkage“ zwischen der
Irakkrise und dem israelisch-palästinensischen Konflikt. Er übte Kritik
an dem bevorstehenden Gespräch Fischers mit Arafat. „Dieses Treffen
stellt keinen Beitrag zum Prozess dar, sondern wird Arafat nur das
Gefühl vermitteln, er leite die Dinge, und gleichzeitig Abu-Masen
schwächen“, so der israelische Außenminister. Sein deutscher Amtskollege
beruhigte ihn: „Ich kenne Arafat gut, und ich weiß, wie ich ihm die
Prioritäten zu erklären habe. Seit dem Anschlag im Delphinarium weiß ich
auch, was man von ihm erwarten kann.“
Fischer brachte die
Roadmap zur Sprache und stellte Shalom Fragen zu den
israelischen Vorbehalten. „Sie fordern in einer frühen Phase des Prozess
von den Palästinensern, auf das Rückkehrrecht zu verzichten. Das wird
Fortschritte sehr erschweren“, sagte er. Shalom antwortete: „Die
Palästinenser erwarten, in einer frühen Phase einen Staat zu erhalten,
nicht am Ende des Prozess. Der Verzicht auf das Rückkehrrecht muss in
einer frühen Phase stattfinden, nicht am Ende, im Gegensatz zum
Oslo-Prozess, in dem auch der palästinensische Staat am Ende des Prozess
stand.“
Fischer traf gestern auch mit MP Sharon zusammen, sowie mit
Oppositionsführer Mitzna. Justizminister Lapid sagte
sein Treffen mit Fischer ab, nachdem der deutsche Minister sich
geweigert hatte, in Lapids Amt in Ostjerusalem zu kommen. Fischer schlug
vor, Lapid zum Frühstück in sein Hotel in Jerusalem einzuladen, der
Justizminister bestand jedoch darauf, ihn in seinem Amt zu empfangen.
Heute wird Fischer weitere israelische Vertreter treffen, drunter Jossi
Beilin, und wird mit Silvan Shalom zu Abend essen. Morgen wird er nach
Ramallah fahren, wo er mit Arafat und Abu-Masen zusammentreffen wird.
Der deutsche Außenminister wird mit den Mitgliedern des Außen- und
Sicherheitskomitees zusammentreffen. Der Vorsitzende des Komitees, MdK
Juval Steinitz (Likud) sagte, bei dem Treffen würden die
deutsch-israelischen Beziehungen erörtert, wie auch die politischen
Entwicklungen, die nach dem Krieg in Irak in der Region erwartet werden.
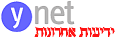
Tova Zimuki und
Itamar Eichner berichten in Jedioth über das gescheiterte Treffen
Fischers mit dem neuen Justizminister Lapid (Schinuj).
Der Vorfall, der den Besuch des
deutschen Ministers überschattete
Eine schwere Wolke überschattete den
Besuch des deutschen Außenministers, Joschka Fischer, in Israel:
Justizminister Josef Lapid sagte sein Treffen mit ihm ab, nachdem
Fischer sich geweigert hatte, in sein Amt zu kommen, das sich in
Ostjerusalem befindet.
Stellen im Außenministerium äußerten ihr
Bedauern über den Vorfall und sagten: „Fischer ist ein echter Freund
Israels, und Lapid hätte nicht darauf bestehen müssen, sich ausgerechnet
im Osten der Stadt mit ihm zu treffen.“
Lapid erklärte gestern: „Jerusalem ist die Hauptstadt Israels, und der
deutsche Außenminister wird uns nicht vorschreiben, welche Teile der
Stadt sich unter unserer souveränen Herrschaft befinden.“ Lapid
erklärte, er habe nichts gegen Fischer und betonte, seine Entscheidung
habe nichts mit seinem Verhältnis zu Deutschland zu tun.
Lapid lehnte die Bitte Fischers ab, sich mit ihm im „King David Hotel“
zu treffen und erklärte: „Wenn er nicht nach Ostjerusalem kommt, dann
komme ich mit Sicherheit auch nicht zu ihm.“
Stellen im Außenministerium bezeichneten Fischer gestern als einen „der
besten Freunde Israels in Europa“. Sie nannten das Verhalten Lapids
„zänkisch“ und fügten hinzu, ausländische Außenminister würden sich
normalerweise nie in israelischen Institutionen in Ostjerusalem
aufhalten.
Fischer sagte später, er werde sich dennoch um ein Treffen mit Lapid im
Westen der Stadt bemühen oder telefonisch mit ihm sprechen.
MP Sharon und AM Shalom trafen gestern mit Fischer zusammen und sagten
zu ihm, sein Treffen mit Arafat sei ein Fehler und würde die Position
Abu-Masens schwächen. Fischer antwortete: „Man darf nicht vergessen,
dass Arafat der erste war, der vorgeschlagen hat, die palästinensische
Führung auszuwechseln und Reformen einzuführen, und er darf nicht das
Gefühl erhalten, ignoriert zu werden. Das könnte ihn unter Druck
setzten.“ Sharon bat Fischer sicherzustellen, dass Abu-Masen über echte
Autoritäten verfügt und ihn dringend auffordern, den Terror zu
bekämpfen.
Fischer, der als einer der größten Gegner des Kriegs in Irak gilt,
überraschte, als er sagte: „Jetzt, nachdem der Krieg ausgebrochen ist,
hoffen wir, dass das diktatorische Regime Saddam Husseins gestürzt
wird.“
Auswärtiges Amt - offiziell:
Die deutsche
Nahostpolitik
Stand: März 2003
- Nahostpolitik als Schwerpunkt
deutscher Außenpolitik
- Engagement der Europäischen
Union
- Diplomatische Anstrengungen
seit Herbst 2001 – Bildung des "Quartetts"
- Deutsches Nahost-Ideenpapier
- Nahostrede von US-Präsident
Bush am 24. Juni 2002
- Die "Roadmap"
- Finanzielle Unterstützung der
Europäischen Union für die palästinensischen Gebiete
- Deutsche
Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe
1 Nahostpolitik als Schwerpunkt
deutscher Außenpolitik
2002 war erneut ein Jahr, in dem die Suche nach Möglichkeiten zur
Fortsetzung des Friedensprozesses im Nahen Osten im Mittelpunkt der
deutschen und europäischen Nahostpolitik stand. Auch bei den Reisen von
Bundesaußenminister Fischer in die Region sowie bei seinen regelmäßigen
Kontakten mit Vertretern der beiden Konfliktparteien stand dies im
Vordergrund. Terroranschläge und massive Vergeltungsmaßnahmen Israels
bestimmten das Geschehen. Alle Bemühungen, auch der Konfliktparteien
selbst, zu einem Einstieg in den sog. "Mitchell-Tenet-Fahrplan" aus dem
Jahr 2001 scheiterten. Es kam weder zu einem tragfähigen
Waffenstillstand noch auch nur ansatzweise zu vertrauensbildenen
Maßnahmen, welche die Grundlage für die Wiederaufnahme von politischen
Verhandlungen hätten bilden können.
Immer wieder ereigneten sich Terroranschläge und
gewaltsame Zwischenfälle, häufig gerade dann, wenn sich eine Beruhigung
der Lage und ein Hoffnungsschimmer auf greifbare politische Fortschritte
abzuzeichnen schien. Die Maxime von Premierminister Sharon, "Keine
Verhandlungen unter Feuer", bestimmte den Kurs der israelischen
Regierung, die bis Ende Oktober 2002 von einer Koalition unter
Einschluss der Arbeitspartei mit Shimon Peres als Außenminister
mitgetragen wurde. Das Auseinanderbrechen der israelischen "Koalition
der Nationalen Einheit" am 31. Oktober 2002 erfolgte letztlich ebenfalls
an einer zentralen Frage des Konflikts: an der Frage des
Haushaltsbudgets für die israelischen Siedlungen in den
palästinensischen Gebieten für das Jahr 2003.
2 Engagement der Europäischen Union
Die deutsche Nahostpolitik war wie in den Vorjahren eng in die
Gemeinsame Nahostpolitik der EU eingebunden. Auch für die EU war der
Nahostkonflikt ein Schwerpunkthema, zu dem sich die europäischen
Staats-und Regierungschefs auf ihren Gipfeltreffen mehrfach und in sehr
dezidierter Form geäußert haben. Hervorzuheben ist die entschiedene
Verurteilung des palästinensischen Terrors, der durch absolut nichts zu
rechtfertigen ist. Der Europäische Rat bekräftigte bei seinem
Treffen im Dezember 2002 in Kopenhagen, dass der Terror der
palästinensischen Sache einen nicht wiedergutzumachenden Schaden
zugefügt. Gleichzeitig sagte die EU jenen Palästinensern, die den
Reformprozess voranbringen und der Gewalt ein Ende setzen wollen, ihre
Unterstützung zu.
3 Diplomatische Anstrengungen seit
Herbst 2001 – Bildung des "Quartetts"
Vor dem Hintergrund der krisenhaften Entwicklung in der Region
begleitete und unterstützte die Bundesregierung bilateral wie auch
gemeinsam mit ihren EU-Partnern alle nahostpolitischen Bemühungen der
internationalen Gemeinschaft und brachte eigene Beiträge ein. Grundlage
war das von US-Präsident Bush in seiner
Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10. November
2001 anvisierte Ziel einer künftigen Nahostlösung: Zwei Staaten,
Israel und – namentlich erstmals in der Geschichte der
US-Nahostdiplomatie genannt - Palästina, die in Frieden innerhalb
sicherer und anerkannter Grenzen Seite an Seite leben. Der Gipfel der
Arabischen Liga in Beirut bestätigte am 27./28. März 2002 die saudische
Friedensinitiative, mit der die arabischen Staaten Israel nach einem
Rückzug aus den besetzten Gebieten normale nachbarschaftliche
Beziehungen anboten. Unter spanischer EU-Präsidentschaft schlossen sich
vier der wichtigsten internationalen Hauptakteure im Nahostkonflikt, die
USA, die EU, Russland und der Generalsekretär der Vereinten Nationen am
10. April 2002 in Madrid zum
sogenannten "Nahost-Quartett" zusammen, um sich künftig in Nahostfragen
enger abzustimmen.
4 Deutsches Nahost-Ideenpapier
Nach einer neuerlichen Eskalation in den Ostertagen 2002 und unter
Berücksichtigung der geschilderten Entwicklung und Initiativen versuchte
Deutschland Anfang April 2002, durch ein Nahost-Ideenpapier neue
Bewegung in den politischen Prozess zu bringen. Seine Kernaussagen: Die
Parteien sind ohne Hilfe von außen zu keiner Konfliktlösung mehr in der
Lage. Notwendig sind daher ein Weg- und Zeitplan, wie das
Zwei-Staaten-Ziel erreicht werden kann; eine dritte Partei, die den
Prozess überwacht; eine internationale Sicherheitskomponente und die
Demokratisierung der palästinensischen Institutionen, da ein künftiger
palästinensischer Staat an der Seite Israels nur bei von Grund auf
reformierten demokratischen Institutionen überlebensfähig ist.
5 Nahostrede von US-Präsident Bush
am 24. Juni 2002
Die
Nahostrede von US-Präsident Bush reflektierte zentrale Punkte des
deutschen Ideenpapiers, u. a. den Gedanken eines Weg- und Zeitplans
sowie die Forderung einer Reform der palästinensischen Institutionen.
Der neue Zielplan sieht Schaffung eines palästinensischen Staates und
den Abschluss eines Endstatusabkommens innerhalb von drei Jahren, d.h.
bis 2005 vor.
Eine erste Operationalisierung der Bush-Rede erfolgte
durch eine deutsche Initiative von Anfang Juli 2002, welche erstmals
versuchte, den von Präsident Bush vorgegebenen Dreijahreszeitraum 2002
bis 2005 weiter zu konkretisieren. Die Grundgedanken des deutschen
Vorschlags waren
- die Ernennung eines palästinensischen
Premierministers,
- ein von Sicherheitsfortschritten begleiteter
Dreistufenplan, bestehend aus Demokratisierung der palästinensischen
Institutionen einschl. Wahlen, provisorischem palästinensischen
Staat und Endstatus-Abkommen,
- die Ernennung eines internationalen Beauftragten
mit Befugnis zur Durchsetzung dieses Reformprogramms.
Zur weiteren Behandlung wurden noch im Juli die
zuständigen EU-Gremien befasst.
6 Die "Roadmap"
Die EU-Außenminister billigten bei ihrem informellen Treffen in
Helsingör am 30./31. August 2002 den Text einer von der Präsidentschaft
vorgelegten "EU-Roadmap", die sich im Wesentlichen an dem deutschen
Papier orientierte. Die EU übernahm den Dreistufenplan für den Zeitraum
2002 bis 2005 und alle wichtigen Einzelelemente einschließlich der
Premierminister-Idee. Das Nahost-Quartett beschloss am 17. September
2002, die EU-Vorstellungen zu einem gemeinsamen Roadmap-Text des
Quartetts zu verschmelzen. Die Einigung auf einen gemeinsamen Text
erfolgte u.a. nach Textverhandlungen zwischen den USA und der EU beim
Quartett-Treffen am 20. Dezember 2002 in Washington, an dem
Außenminister Powell, Außenminister Iwanow, der Hohe Repräsentant Solana
und VN-Generalsekretär Kofi Annan teilnahmen. Indossierung und
Veröffentlichung der Quartett-Roadmap wurde auf Wunsch der USA auf einen
Zeitpunkt nach den israelischen Wahlen verschoben.
Der Mehrwert der jetzt auf dem Tisch liegenden Roadmap
des Quartetts gegenüber den Mitchell-Empfehlungen besteht im
Wesentlichen schon vor offizieller Indossierung in folgenden
Hauptpunkten:
- Die Roadmap ist der erste gemeinsame Text der vier
Nahost-Hauptakteure USA, EU, Russland und Generalsekretär der
Vereinten Nationen in der Geschichte des Nahostkonflikts überhaupt.
Auch die Konfliktparteien haben ihn im Prinzip akzeptiert.
- Die Roadmap hat die politische Unterstützung aller
Mitglieder des Quartetts. Sie haben den Fahrplan in seiner Fassung
vom 20. Dezember als Grundlage für seine Umsetzung finalisiert.
- Erstmals soll eine dritte Partei - das Quartett -
künftig über Fortschritte bei der Implementierung entscheiden.
- Außerdem hat sich das Quartett durch eine eigens
eingerichtete Task Force der geforderten palästinensischen Reformen
aktiv angenommen und unterstützt diese vor Ort, u. a. in den
Bereichen Reform der Institutionen und im Finanzsektor.
7 Finanzielle Unterstützung der
Europäischen Union für die palästinensischen Gebiete
Die Europäische Union (Gemeinschaft und Mitgliedstaaten) war auch
2002 der größte internationale Geber finanzieller Unterstützung für den
Nahost-Friedensprozess. Die EU-Hilfen, zu denen Deutschland 25%
beiträgt, haben angesichts der Verschärfung der politischen und
wirtschaftlichen Krisensituation im Nahen Osten eine wichtige
stabilisierende Funktion. Nachdem Israel mit Ausbruch der "Zweiten
Intifada" den Transfer von Zoll- und Steuereinnahmen an die
Palästinensische Behörde eingestellt hatte, drohte deren finanzieller
Zusammenbruch. Zur Sicherstellung der Zahlung von Gehältern,
insbesondere im palästinensischen Bildungs- und Gesundheitssektor hat
die EU der Palästinensischen Behörde im Jahr 2002 insgesamt 120 Mio EUR
Budgethilfe geleistet. Die Finanzhilfen sind an Auflagen gebunden, deren
Einhaltung vom IWF überwacht wird. Neben der Kontrolle der
Mittelverwendung erstrecken sich die Auflagen auch auf Reformen in
Politik, Verwaltung und Finanzen. Mittlerweile gehört der Finanzbereich
sogar zu den Bereichen, in denen die palästinensischen Reformbemühungen
am sichtbarsten vorangekommen sind. Auch Israel hat inzwischen mehrere
Überweisungen an die palästinensischen Behörden getätigt. Die
UN-Organisation zur Betreuung
palästinensischer Flüchtlinge UNRWA (United Nations Relief and Works
Agency for Palestine Refugees in the Near East) erhielt aus EU-Mitteln
weitere 55 Mio EUR für Ausbildungs- und Gesundheitsprogramme. Für 17,2
Mio EUR wurden humanitäre und Nahrungsmittelhilfe geleistet.
8 Deutsche
Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe
Die Bundesregierung unterstützte im Jahr 2002 UNRWA direkt mit
insgesamt 10,6 Mio EUR. Im Rahmen der bilateralen
Entwicklungszusammenarbeit hat die Bundesregierung den Palästinensischen
Gebieten 2002 insgesamt 50,21 Mio EUR zugesagt. Die Zusagen sind
projektgebunden. Neben dem Schwerpunktbereich Wasser konzentrieren sich
die Vorhaben v.a. auf die Förderung der Privatwirtschaft und den Aufbau
effizienter Vewaltungsstrukturen. Darüber hinaus wird umfangreiche
humanitäre Hilfe geleistet.
hagalil.com
14-04-03 |